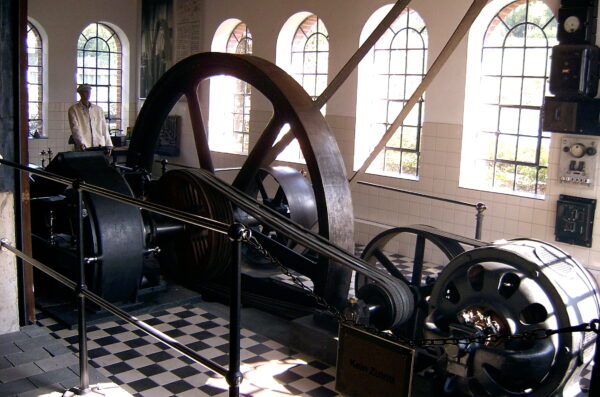Volkswirtschaft
- Volkswirtschaft und Volkswirtschaftslehre – Grundbegriffe die jeder kennen sollte
- Womit sich die Volkswirtschaftslehre im Detail befasst
- So unterscheiden sich offene und geschlossene Volkswirtschaften
- Märkte in der Volkswirtschaft und ihre Funktionsweise
- Die Volkswirtschaftslehre – fachlich unterteilt in Mikroökonomie und Makroökonomie
- Fazit: Volkswirtschaft und Volkswirtschaftslehre betrifft alle Menschen
Volkswirtschaft und Volkswirtschaftslehre – Grundbegriffe die jeder kennen sollte
Jeder Einwohner eines Landes gehört zu einer Volkswirtschaft. Als Volkswirtschaft in seiner Gesamtheit definiert man alle Unternehmen, Privathaushalte sowie die Behörden und Einrichtungen des Staates. Grundsätzlich gehört jeder, der Produkte herstellt oder konsumiert zu einer Volkswirtschaft.
Die wesentlichste Kennzahl jeder Volkswirtschaft ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP). Mit dem Bruttoinlandsprodukt misst man die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft zu einem definierten Zeitpunkt. Vergleicht man die größten Volkswirtschaften der Welt, kann man in Bezug auf die Wirtschaftsleistung eindeutige Unterschiede feststellen. Die Weltbank gibt für die Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 2019 zum Beispiel ein BIP von 3,861 Billionen US-Dollar aus. Frankreich liegt im Vergleich mit 2,716 Billionen US-Dollar deutlich dahinter, während Japan mit mehr als 5 Billionen US-Dollar die stärksten Wirtschaftsdaten ausgibt.
Da die Wirtschaftsleistung, globalisierte Märkte, die politischen Rahmenbedingungen und andere Einflussfaktoren für Volkswirtschaften fortlaufenden Veränderungen unterliegen, untersucht die Volkswirtschaftslehre in Analysen und Modellen, welche Zusammenhänge bei der Produktion und der Verteilung von Gütern und Produktionsfaktoren bestehen. Die Volkswirtschaftslehre beschäftigt sich mit den Gesetzmäßigkeiten, die die allgemeine Wirtschaft in ihrer Gesamtheit bestimmen.
Sie schließt die Bereiche Agrarwirtschaft, Finanzwirtschaft, Geldwirtschaft, Gesundheitswirtschaft, Sozialwirtschaft und Tourismuswirtschaft mit ein. Die Volkswirtschaftslehre ist eine praxisbezogene Wirtschaftswissenschaft, die alle Bereiche des Wirtschaftswachstums und der Wirtschaftsentwicklung umfasst.
Dieser Artikel gibt einen Überblick darüber, wie Volkswirtschaften und Märkte funktionieren und was der Unterschied zwischen einer offenen und einer geschlossenen Volkswirtschaft ist. Ebenso geht er auf die beiden Untergruppen der Volkswirtschaftslehre, die Mikroökonomie sowie die Makroökonomie ein. Das die Volkswirtschaft sich häufig mit abstrakten Totalmodellen auseinandersetzt, wird im Artikel in Kürze das „Zwei-Sektoren-Modell“ erklärt. Außerdem zeigt die Abhandlung detailliert auf, warum es für Unternehmen und ebenso für Privatleute wichtig ist, die wesentlichen Fakten zur Volkswirtschaftslehre zu kennen.
Womit sich die Volkswirtschaftslehre im Detail befasst
Die Volkswirtschaftslehre ist eine praxisbezogene und gleichzeitig in vielen Teilen abstrakte Disziplin der Wirtschaftswissenschaften. Sie befasst sich mit elementaren Fragen und grundlegenden wirtschaftlichen und sozialen Themen, die jeden Bürger fortlaufend tangieren.
Im Fokus der Volkswirtschaftslehre steht die Verbindung von Wirtschaft und menschlichem Handeln. Die Volkswirtschaftslehre, die typischerweise mit dem Kürzel „VWL“ abgekürzt wird, zeigt die Schnittmengen, Verflechtungen und Abhängigkeiten auf, die zwischen Staat und Wirtschaft bestehen. Als Studienfach an einer Hochschule kann man die Volkswirtschaftslehre in sechs Semestern studieren, sofern man die Regelstudienzeit einhält.
Wer sich persönlich oder aus beruflichen Gründen für die Volkswirtschaftslehre interessiert, stellt schnell fest, dass alle Fragestellungen in der Volkswirtschaftslehre einen praktischen Bezug haben. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn die wirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten für ein einzelnes Unternehmen in der Mikroökonomie oder für die Wirtschaft im Gesamten in der Makroökonomie beleuchtet werden. In der VWL spielen mathematische, methodische und analytische Analysen und Herangehensweise eine wichtige Rolle. Statistiken sind essenziell, um wirtschaftliche Verflechtungen zu verstehen oder Entschlüsse abzuleiten.
Im Fachbereich der Wirtschaftswissenschaften kann man die Volkswirtschaften nicht getrennt betrachten. Die Volkswirtschaft hat als Oberbegriff viele Schnittmengen und Einflussfaktoren auf die folgenden Themengebiete:
| Oberbegriff | Detailinformationen |
| Betriebswirtschaftslehre | Die Betriebswirtschaftslehre (BWL) befasst sich mit organisatorischen, kalkulatorischen und planerischen Entscheidungen in Betrieben und Unternehmen. Sie nimmt die Sichtweise der Betriebe ein und ist neben der Volkswirtschaftslehre die zweite wichtige Säule der Wirtschaftswissenschaften. |
| Finanzwirtschaft | Wesentlicher Wirtschaftszweig in der Volkswirtschaftslehre, der alle Unternehmen inkludiert, die sich mit Finanzierung und Finanzen beschäftigen. Hierzu gehören unter anderem Banken und Versicherungen. |
| Wirtschaftsinformatik | Das wichtige Thema der Digitalisierung tangiert neben Privathaushalten vor allem die Wirtschaft. Unternehmen und die Volkswirtschaft als Ganzes muss auf globalisierten Märkten bestehen können. Dies gelingt vor allem durch einen richtigen Einsatz innovativer Technik. Die Wirtschaftsinformatik beschäftigt sich im Detail mit den Disziplinen Digitalisierung, Kommunikation und Information in Unternehmen. |
| Wirtschafts- und Sozialpolitik | Jede Volkswirtschaft ist in ein politisches System eingebunden. Die Politik gibt die Wirtschafts- und Sozialpolitik eines Landes durch Gesetze und Rechtsverordnungen vor. |
| Wirtschafts- und Steuerrecht | Das Wirtschafts- und Steuerrecht umfasst die Definitionen von Rechtseinheiten, die Regeln zur Geschäftsbetriebsführung, Bestimmungen zum Investitions- und Forderungsmanagement sowie Direktiven zum Personalmanagement. Das Wirtschafts- und Steuerrecht ist vor allem mit der Managementebene eines Unternehmens verknüpft. Die Unternehmensleitung ist dafür zuständig, den Rahmen für das Investitions- und Forderungsmanagement, das Personalmanagement sowie das Vertrags- und Vertriebsmanagement zu setzen. |
| Wirtschafts- und Sozialgeschichte | Ein Rückblick auf die Wirtschafts- und Sozialgeschichte einer Volkswirtschaft ist wichtig, um Zusammenhänge zu verstehen und zukunftsorientierte Entscheidungen treffen zu können. Wer durch Analysen und Modelle nachvollziehen kann, durch welche volkswirtschaftlichen Stellschrauben das Wirtschaftswunder in den 1960-er-Jahren in Deutschland möglich wurde, kann statistisch ableiten, wie ein erneuter wirtschaftlicher Aufschwung möglich ist. |
| Ökonometrie | Ökonometrie ist eine quantitative Disziplin der Ökonomie, die auf der mathematischen Analyse von Daten auf Grundlage der sozialwirtschaftlichen und ökonomischen Theorien aufbaut. Ökonometrische Analyse werden zu komplexen Themen wie beispielsweise zur Mikroökonomie, Arbeitsmarktforschung, Bildungsökonomie, Gesundheitsökonomie, Entwicklungsökonomie oder zur Wirtschaftspolitik vorgenommen. |
| Volkswirtschaftstheorie | In der Volkswirtschaftstheorie geht es hauptsächlich um die Analyse und Beantwortung von Fragen aus einem breiten Spektrum wirtschaftlicher Zusammenhänge. Beispielsweise wird erörtert, wie die Preise auf den Warenmärkten zustande kommen oder wie Märkte funktionieren. |
| Financial Mathematics (Finanzmathematik) | Die Finanzmathematik bezieht sich auf die Anwendung mathematischer Methoden auf Finanzprobleme. Sie stützt sich auf Werkzeuge aus der Wahrscheinlichkeitsberechnung, der Statistik, aus stochastischen Prozessen sowie auf die Wirtschaftstheorie. |
Studenten der Volkswirtschaftslehre bearbeiten die genannten Themen in einem Bachelor- und Masterstudiengang intensiv. Da die VWL praxisrelevante Themenbereiche aus dem Wirtschaftsleben thematisiert, lernen Studenten ebenfalls, wie wissenschaftliches Arbeiten und der Aufbau von Totalmodellen, Analysen und Statistiken funktioniert. Darüber hinaus professionalisieren sie Softskills wie ihre individuelle Sozialkompetenz, Rhetorik oder das Präsentieren von Fakten.
In welchen Branchen Volkswirte gefragt sind
Aufgrund des starken Praxisbezugs der Volkswirtschaftslehre werden Volkswirte überall dort benötigt, wo Wirtschaftsthemen und der Aufbau von Modellberechnungen und Statistiken im Vordergrund stehen. Aus diesem Grund findet man studierte Volkswirte im öffentlichen Dienst, in Forschungsinstituten und ebenso in der freien Wirtschaft in global agieren Konzernen und KMU.
Typische Berufsbilder für Volkswirte sind die Bereiche Consulting, Business Development, Transfer Pricing oder eine Tätigkeit als Redakteur oder Journalist in Medienunternehmen. Volkswirte sind grundsätzlich gefragte Fachkräfte, da sie aufgrund ihrer fundierten wissenschaftlichen Ausbildung in der Lage sind:
- Volkswirtschaftliche Zusammenhänge zu erkennen,
- Schwierige wirtschaftliche Zusammenhänge effektiv zu erklären und
- Fakten und Analysen in Entscheidungsprozesse einzuarbeiten.
Durch die fortschreitende Digitalisierung und die Globalisierung von Märkten wächst die Komplexität von Themen im Bereich der Volkswirtschaften, sodass facherfahrene Volkswirte in Unternehmen aller Größenordnung alternativlos sind.
So unterscheiden sich offene und geschlossene Volkswirtschaften
Spricht man von einer Volkswirtschaft, ist grundsätzlich das gesamte Wirtschaftssystem eines Landes gemeint. Dieses beinhaltet alle Sektoren wie beispielsweise Beschäftigung, Produktion, Währung, Lohn, Kapital, Verbraucher, Staatsausgaben, Steuern, Politik und viele weitere. Obwohl die meisten Volkswirtschaften ähnlich aufgebaut sind, gleicht keine Volkswirtschaft der anderen. Volkswirtschaften haben unterschiedliche Charakteristika, die sich unter anderem durch die Höhe der Staatsausgaben oder den Grad der Staatsverschuldung definieren. Außerdem unterscheidet man zwischen offenen und geschlossenen Volkswirtschaften.
In der Makroökonomik arbeiten Wissenschaftler mit dem theoretischen Modell der geschlossenen Volkswirtschaft. In diesen abgeschotteten, nicht realen Konstrukten findet kein Handel außerhalb des eigenen Wirtschaftsraums statt. Es herrscht Autarkie, da Exporte und Importe sowie der Transfer von Kapital ausschließlich im eigenen Land stattfinden. Da keine Volkswirtschaft dieser Erde ohne Import und Export existieren kann, handelt es sich vor um abstrakte und theoretische Modelle. Dies gilt ebenfalls für totalitär regierte Länder wie Nordkorea, den Iran oder Kuba. Selbst wenn einige Staaten wirtschaftlich vorsichtig agieren und sich abschotten, sind komplett geschlossene Volkswirtschaften Fiktion und ausschließlich in wissenschaftlichen Modellen existent.
Die meisten Volkswirtschaften der Erde gelten im Gegensatz als offene Volkswirtschaften. Sie erlauben den freien Import von Gütern, Dienstleistungen, Kapital und Investitionen. Um eigene Interessen durchzusetzen, reglementieren sie diesen durch Handelsverträge und Strafzölle. Beispielsweise gelten die USA, Japan oder die Bundesrepublik Deutschland als eine offene Volkswirtschaft. Ohne einen offenen und freien Handel nach den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) könnten Volkswirtschaften nicht wachsen und sich nicht weiterentwickeln. Die Globalisierung oder Vernetzung dieser Welt trägt ihr Übriges dazu bei, dass geschlossene Volkswirtschaften im realen Leben praktisch unmöglich sind.
Zusammenfassend unterscheidet man bei Volkswirtschaften zwischen einer offenen und einer geschlossenen Volkswirtschaft. Während offene Volkswirtschaften eine höhere Gesamtproduktivität verzeichnen, sind geschlossene Volkswirtschaften in den meisten Fällen stark konzentriert. Länder mit einer nahezu geschlossenen Volkswirtschaft konzentrieren sich auf die Produktion von wenigen Gütern. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass geschlossene Volkswirtschaften ein höheres Bruttoinlandsprodukt ausweisen können.
Das Zwei-Sektoren-Modell: Untersuchung zu Wechselwirkungen von Haushalten vs. Unternehmen
Ein einfaches volkswirtschaftliches Totalmodell, das die Wechselwirkung von Haushalten und Unternehmen untersucht, ist das „Zwei-Sektoren-Modell.“ Dieses abstrakte Modell spielt in geschlossenen Volkswirtschaften. Während die meisten anderen Modelle Untersuchungen in offenen Volkswirtschaften mit einem Staat und mit Handelsbeziehungen ins Ausland begutachten, wird beim Zwei-Sektoren-Modell ausschließlich die Beziehung zwischen Unternehmen und Konsumenten aus privaten Haushalten berücksichtigt.
Ziel der Untersuchung im Zwei-Sektoren-Modell ist es, Informationen über die Bereiche Beschäftigung, Produktion, Investitionen, Konsum und das Volkseinkommen zu extrahieren. Hierbei bedient man sich des folgenden Modells:
- Unternehmen beschäftigen Mitarbeiter (private Haushalte).
- Unternehmen stellen Produkte her.
- Private Haushalt arbeiten in Unternehmen.
- Private Haushalte fragen Güter nach.
Der Staat und seine regulatorischen Interventionen sowie Handelsbeziehungen zu anderen Ländern spielen keine Rolle. In abstrakten Analysen kann mit dem Zwei-Sektoren-Modell das Volkseinkommen als gesamtwirtschaftliche Nachfrage errechnet werden. Außerdem ist es möglich, das Gesetz von Angebot und Nachfrage mit diesem Modell nachzuweisen.
Zusammenfassend zeigt das Zwei-Sektoren-Modell in engen Grenzen die wirtschaftswissenschaftlichen Fakten einer geschlossenen Volkswirtschaft auf. Das Modell ist nicht praxisbezogen, da als wesentliche Einflussfaktoren der Staat und internationale Handelsbeziehungen sowie globalisierte Märkte nicht berücksichtigt werden. Aus diesem Grund bietet das Zwei-Sektoren-Modell einen begrenzten Einblick und beschreibt mit elementaren Mitteln, in welcher Abhängigkeit Unternehmen und Haushalte stehen.
Märkte in der Volkswirtschaft und ihre Funktionsweise
Beschäftigt man sich mit Wirtschaftsthemen, kommt man nicht umhin, sich mit unterschiedlichen Märkten zu beschäftigen. Ähnlich wie auf einen statischen Marktplatz in einer Kleinstadt verschiedene Lebensmittelhändler ihre Waren und Dienstleistungen verkaufen, funktionieren die Märkte, von denen in der Volkswirtschaftslehre die Rede ist. Aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht bezeichnen Märkte den Ort, an dem Angebot und Nachfrage zusammentreffen. Angebot und Nachfrage nach einem bestimmten Gut oder einer Dienstleistung bestimmen in der Folge den Preis für das Produkt.
Die Märkte der Volkswirtschaft sind somit der Ort, an dem Produzenten und Konsumenten Waren und Dienstleistungen handeln. In einem Tauschgeschäft erhält der Konsument die Ware und bezahlt für diese einen festgelegten Preis. Der Begriff des Marktes in der Volkswirtschaft ist nicht räumlich zu verstehen. Begriffe wie „Mobilfunkmarkt,“ „Arbeitsmarkt“ oder „Automobilmarkt“ deuten an, dass es sich bei Märkten aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht um abstrakte Märkte handelt.
Unterschiedliche Interessen von Marktteilnehmern
Jeder Markt besteht aus verschiedenen Marktteilnehmern. Diese verfolgen unterschiedliche Interesse und sind auf dem Markt mit unterschiedlichen Zielvorstellungen vertreten. Während die Ziele der Verkäufer darin bestehen, einen möglichst hohen Preis zu erzielen, stehen die Motive der Käufer diametral entgegen. Sie versuchen, Waren oder Dienstleistungen möglichst preisgünstig einzukaufen. Steigt die Nachfrage, vergrößern die Verkäufer die Angebotsmenge. Bei sinkender Nachfrage verkleinert sich das Angebot.
Getreu dem bekannten Motto: „Konkurrenz belebt das Geschäft,“ besteht ein Markt in den meisten Fällen nicht aus einem Käufer und einem Verkäufer sondern aus vielen Kunden, um deren Gunst unterschiedliche Unternehmen als Verkäufer buhlen. Der Markt bildet für diese antagonistischen Interessengruppen einen geschützten Raum. Unter anderem erfüllt er die Aufgabe:
- Angebot und Nachfrage zu konsolidieren,
- Die verschiedenen Marktteilnehmer zueinander zu führen sowie
- Kunden über unterschiedliche Angebote zu informieren.
Märkte können von den Ordnungsbehörden reguliert werden. In diesem Fall erhalten Marktteilnehmer ausschließlich Zugang, wenn sie die vorab definierten Voraussetzungen erfüllen. Auf Märkten mit unbeschränktem Zugang können alle Marktteilnehmer agieren. Auf geschlossenen Märkten, die durch ein gesetzliches Gebot gesperrt werden, darf nicht verkauft werden. Ein typischer, geschlossener Markt ist der Markt für illegale Drogen. Grundsätzlich können Märkte diversifiziert und in unterschiedliche Markttypen eingeteilt werden.
Die Volkswirtschaftslehre – fachlich unterteilt in Mikroökonomie und Makroökonomie
Unter dem Oberbegriff Wirtschaftswissenschaften werden sowohl die Betriebswirtschaftslehre (BWL) und ebenso die Volkswirtschaftslehre (VWL) zusammengefasst. Während die Betriebswirtschaftslehre den Blickwinkel von Unternehmen auf Märkten einnimmt, beschäftigt sich die Volkswirtschaftslehre abstrakt mit dem Wirtschaften auf unterschiedlichen Märkten. Hierfür nutzt die VWL Statistiken, Totalmodelle und Analysen und vergleicht die verschiedenen Parameter miteinander. Das Bruttoinlandsprodukt oder das Bruttosozialprodukt sowie weitere Gesamtrechnungen sind typische Indikatoren der Volkswirtschaftslehre.
Unterteilt wird die Volkswirtschaftslehre hierbei in zwei Untergruppen:
- Die Makroökonomie,
- Die Mikroökonomie.
Die Makroökonomie und ihre Sichtweise
Als Makroökonomie bezeichnet man eine wichtige Wirtschaftstheorie (vom griechischen „Makros“ = Groß). Sie betrachtet die Gesamtwirtschaft, die eine Nation mit einer einheitlichen Zentralbank und einer einheitlichen Währung umfasst.
Der Fokus liegt bei Makroökonomie auf der langfristigen Analyse der politischen Angelegenheiten der Volkswirtschaft. Die Makroökonomie verfolgt das Ziel, die Politik der Wirtschaft zu verbessern und die Auswirkungen auf die quantitative Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft zu ermitteln. In das makroökonomische System fließen das Konjunkturgefüge, die Wettbewerbskonkurrenz, die Geldpolitik und die Regulierungen der Regierung ein. Ein Beispiel für eine makroökonomische Analyse ist die monatliche Arbeitslosenstatistik. Sie ermittelt alle Arbeitslosen in einem definierten Umfeld, zum Beispiel in Gesamtdeutschland.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die Makroökonomie ein nicht-fachgebundenes Gebiet mit wenigen Vertretern. Richard Kahn, der der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Londoner Universität entstammte, wurde einer der Väter der Makroökonomie.
In seinem Buch „A Treatise on Money“ definierte er seine Theorie der Preispolitik, die auf dem Gedanken basierte, dass die Produktion und Verteilung von Gütern und der Austausch von Gütern zwischen verschiedenen Wirtschaftssektoren sowie die Lohnpolitik alle mit den Preisen in Zusammenhang stehen. Eine der wichtigsten Verbindungen zwischen Makroökonomie und der Volkswirtschaftslehre ist die Theorie der Zentralparität. Diese besagt, dass die verschiedenen makroökonomischen Variablen in einem Land (wie beispielsweise Einkommen, Preis und Beschäftigung) in einer bestimmten Weise miteinander verknüpft sind. Jeder Einfluss auf eine dieser Variablen hat Auswirkungen auf alle anderen Variablen.
Makroökonomie ist zusammenfassend ein Fachgebiet der Volkswirtschaftslehre, das die allgemeinen Zusammenhänge zwischen verschiedenen makroökonomischen Variablen untersucht. Im Gegensatz zur Mikroökonomie konzentriert sich Makroökonomie auf eine größere Gruppe. Sie untersucht die Wirtschaftszusammenhänge zu anderen Ländern sowie ihre politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Folgen.
Wie sich Mikroökonomie und Makroökonomie ergänzen
Im Gegensatz zur Makroökonomie, die das Verhalten der gesamten Volkswirtschaft untersucht, konzentriert sich die Mikroökonomie kleinteiliger auf die Verhaltensweisen von Einzelnen. Die Mikroökonomie ermittelt das Verhalten von Wirtschaftssubjekten, zum Beispiel von Unternehmen oder privaten Haushalten. Mit der Mikroökonomie verbindet die Volkswirtschaft das Ziel, die Entscheidungen Einzelner zu verstehen.
Beispiel: Aufgrund des menschengemachten Klimawandels hat die Bundesregierung beschlossen, die Klimaziele zu verschärfen. Ein Instrument ist die Förderung der Neuzulassung von Elektrofahrzeugen. Mithilfe der Mikroökonomie wird analysiert, worauf einzelne Verbraucher ihre Entscheidung für den Kauf eines Elektrofahrzeugs gründen. Versteht man durch Analysen und Modelle, wie Angebot, Nachfrage oder Kaufentscheidungen getroffen werden, können Förderprojekte adaptiert und angepasst werden, um das Ziel der CO2-Reduktion zu erreichen.
Die Mikroökonomie kann als ein Teilgebiet der Wirtschaftstheorie verstanden werden, bei dem einzelne wirtschaftliche Phänomene unter Zuhilfenahme von Modellen und Analysen wissenschaftlich untersucht werden.
Fazit: Volkswirtschaft und Volkswirtschaftslehre betrifft alle Menschen
Alle Menschen, die Produkte oder Dienstleistungen ein- oder verkaufen und am Wirtschaftskreislauf beteiligt sind, gehören zu einer Volkswirtschaft. Wörterbücher definieren eine Volkswirtschaft als Gesamtwirtschaft innerhalb eines Volkes. Die Volkswirtschaftslehre ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften. Die Betriebswirtschaftslehre gehört ebenfalls zu den Wirtschaftswissenschaften. Im Gegensatz zur Volkswirtschaftslehre nimmt sie den Standpunkt von Unternehmen und Betrieben ein.
Da sich das Wirtschaften auf globalen Märkten fortlaufend weiterentwickelt und neue Herausforderungen und Chancen entstehen, ist die Volkswirtschaftslehre nicht statisch. Der amerikanische Komiker Danny Kane bemerkte zu Recht, „dass Wirtschaftswissenschaft das einzige Fach ist, in dem jedes Jahr auf dieselben Fragen andere Antworten richtig sind.“
Um die richtigen Antworten auf aktuelle volkswirtschaftliche Fragestellungen zu finden, bedient sich die Volkswirtschaftslehre Analysen, Statistiken und Modellen. Teilweise praxisbezogen und in Teilen abstrakt untersucht sie Märkte und die Abhängigkeiten von unterschiedlichen Marktteilnehmern.
Die Volkswirtschaftslehre kann in zwei Unterrubriken unterteilt werden. Die Makroökonomie untersucht die gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge während die Mikroökonomie in die Tiefe geht. Sie forscht auf der Ebene von Konsumenten und Unternehmen und interessiert sich im Besonderen für deren Motive.
Da die Volkswirtschaftslehre eng mit anderen Fachbereichen, wie der Finanzwirtschaft, dem Wirtschafts- und Steuerrecht, der Ökonometrie und der Wirtschaftspolitik verzahnt ist, gelten erfahrene Volkswirte als Experten auf ihrem Gebiet. Sie verstehen die volkswirtschaftlichen Zusammenhänge und können durch Analysen und Statistiken Rückschlüsse ziehen und Entscheidungen anhand von Modellen wirkungsvoll ableiten.
Die Volkswirtschaftslehre tangiert offensichtlich und unbemerkt jeden Menschen, da alle Menschen in Volkswirtschaften leben und wirtschaften. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Grundbegriffe der Volkswirtschaftslehre zu kennen und zu verstehen, wie eine Volkswirtschaft funktioniert und welche unterschiedlichen Rollen und Marktpartner in einer Volkswirtschaft wichtig sind.